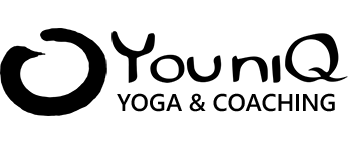Durch ein Yogabuch inspiriert, fing ich mit etwa 17 Jahren an zu meditieren. In dem kurzen Kapitel über Meditation war keine rechte Anleitung zu finden, außer, dass man sich hinsetzen, die Augen schließen und dann nichts weiter tun solle. Das würde die Gedanken stoppen. Ich habe es immer wieder versucht, mir dabei allerdings den Kopf darüber zerbrochen, wie man aufhören soll zu denken – alleine diese Überlegung hat meinen Geist auf Trab gehalten. Ich merkte zwar, dass da irgendetwas passiert, wenn ich nur sitze, doch die Gedanken blieben. Erst viele Jahre später, bei einer Meditationseinführung durch einen Zen-Mönch, habe ich es verstanden: Wir denken immer. Unser Geist ist dafür gemacht zu denken. Meditation ist, wenn man die Gedanken sammelt und bündelt. So, dass sie wie eine Kompassnadel beständig in eine Richtung zeigen. Diese Beschreibung war eine enorme Erleichterung für mich. Es ging also nicht darum, die Gedanken „wegzumachen“.
Aller Anfang ist schwer und wenn einem dann jedes Mal beim Versuch, in die Stille zu gehen der Geist wie ein Wildpferd davongaloppiert und weit davon entfernt ist, sich zähmen zu lassen, motiviert das nicht besonders, sich am nächsten Tag wieder hinzusetzen. Doch genau das braucht dieses innere Wildpferd und was wir für Geduld und Disziplin bekommen, ist es wert:
„Wenn wir unseren Geist durch ruhiges Verweilen schulen, können wir eine Allianz schaffen, die es uns erlaubt, tatsächlich unseren Geist zu nutzen, anstatt von ihm benutzt zu werden. … Begreifen wir erst einmal, wie unser Geist funktioniert, dann sehen wir auch, wie unser Leben funktioniert. Und das verändert uns.“ – Sakyong Mipham in „Wie der weite Raum“
Dass ich täglich begann zu meditieren, habe ich ich den Meditationstechniken aus dem KundaliniYoga zu verdanken. Zum einen haben sie alle ein Thema, ein Ziel; das motiviert und ist greifbarer als das „Nursitzen“. Und meist kommt etwas zu tun hinzu: ein Mudra, eine bestimmte Armhaltung, ein Mantra, eine Bewegung, manchmal alles zusammen. Dadurch wurde mein Begriff von Meditation erweitert. Und: Im KundaliniYoga gibt es eine feste Dauer, über die man die Meditationen machen sollte, damit sie ihre Wirkung entfalten können: 40, 90, 120 oder 1000 Tage und auch die Meditationszeiten sind vorgegeben mit meist 11, 22, 31 Minuten und der Option, sie auf 62 Minuten bis 2,5 Stunden auszudehnen. Das klingt alles erst einmal viel und lang. Doch diese klaren Vorgaben haben mir geholfen, 1000 Tage dranzubleiben. Und dann wurde Meditation jeglicher Art für mich zur Gewohnheit.
Es gibt so viele Arten zu meditieren, dass für jeden etwas dabei ist, egal wie unruhig sie oder er ist. Für den unruhigen Menschen ist es hilfreich, wenn dieser sich vor der Meditation bewegt. Eine Runde joggen geht, Yoga macht, ein paar Sonnengrüße. Wer partout nicht sitzen kann, kann in Bewegung meditieren. Eine außergewöhnliche bewegte Meditation ist die „Heart Chakra Meditation“ von Karunesh. Zur Musik von Karunesh gibt es einfache Bewegungsabfolgen im Stehen – sicherlich auch eine gute Alternative für alle Vielsitzer. In der buddhistischen Tradition gibt es Gehmeditationen. Sie sind wie ein Spaziergang in Zeitlupe, drinnen oder draußen, bei dem die Achtsamkeit auf dem abrollen der Füße und dem Kontakt mit dem Boden liegt. Wer das mit einem mentalen Fokus ergänzen mag, kann dies durch ein Mantra tun oder auch mit einem Satz. Zwei Möglichkeiten, die Thich Nhat Hanh vorschlägt, mag ich besonders gerne: Beim Einatmen denkt man „Ich bin angekommen“, beim Ausatmen „Ich bin zu Hause“. Oder „Ja, ja, ja“ – „danke, danke, danke“. Die Gehmeditation lehrt uns, dass wir immer schon angekommen sind, dass wir genau dort sind, wo wir sein sollen und nirgendwo hin müssen. Damit ist sie ein hilfreiches Gegenmittel für die schnelle Zeit, in der wir leben und für die endlosen ToDo-Listen, die auf uns warten. Der bewusste Kontakt der Füße mit der Erde bringt uns vom Verkopftsein und Gedankenkreisen in eine Ruhe und innere Stabilität.
Wer sitzend meditieren möchte, muss dafür sicherlich nicht warten, bis er den Lotossitz beherrscht. Der Fersensitz, eventuell mit einem Meditationsbänkchen unterstützt, oder der einfache gekreuzte Sitz mit einem Sitzkissen zur Erhöhung tun es auch. Wer auf dem Boden nicht gut sitzen kann, kann auf einem Stuhl Platz nehmen. Bei dieser Art zu meditieren ist es wichtig, dass man mit Leichtigkeit gerade sitzen kann – dafür sind bei den meisten Übenden Sitzerhöhungen nötig, damt die Hüfte höher ist als die Knie und die Wirbelsäule aufrecht, ohne nach hinten in einen runden Rücken gezogen zu werden. Ist die Wirbelsäule müde-schlapp oder angestrengt-verkrampft, ist das Eintauchen in einen meditativen Zustand kaum möglich.
Der richtige Sitz ist eingenommen. Und dann? Nimmt man sich entweder eine der strukturierten KundaliniYoga-Meditationen vor oder lässt sich mit Kopfhörern im Ohr führen – zum Beispiel durch die klassisch buddhistische „Meditation für Anfänger“ von Jack Kornfield oder von den Heilmeditationen von Dr. Joe Dispenza.
Die klassische und für viele die schwierigste Meditationsart ist das Nursitzen „Zazen“ bzw. die Einsichtsmeditation „Vipassana“. Das reine Sitzen, das reine Wahrnehmen in der (relativen) Stille, ohne bestimmte Tätigkeit, nur mit Atembeobachtung. Die Anleitung klingt simpel, doch wer in die Stille möchte, erfährt anfangs oft eine laute Gedankenflut, ständige Ablenkung vom Atem, Langeweile, Hunger, Müdigkeit, der Körper tut weh...einfach alles. Das auszusitzen anstatt aufzustehen und vor sich selbst zu flüchten, ist dabei die hohe Kunst. Mit Zeit und Übung werden das innere Geschwätz und die „niederen Triebe“, die sich melden, weniger oder ebben schneller ab, wenn sie denn da sind. Wir werden ruhiger, gelassener, neutraler und lernen zu agieren statt zu reagieren.
Für mich persönlich ist diese Fähigkeit eines meiner größten Lebensziele.
Und das bringt mich immer wieder dazu, in die Stille zu gehen. Ob im Sitzen, beim Spazieren, während des Abwaschens oder beim Tee trinken.